Abgeschiedenheit, die das Meer in seiner Unendlichkeit noch erhöht. Um zehn Uhr morgens stellte ich mich bei dem Gouverneur, dem Neger Lacascade, vor, der mich wie eine Persönlichkeit von Ansehen empfing. Ich verdankte diese Ehre meiner Mission, mit der die französische Regierung mich -- ich weiß nicht warum -- betraut hatte. Allerdings war es eine künstlerische Mission, aber in den Augen des Negers war dies Wort nur das offizielle Synonym für Spionage, und ich bemühte mich vergebens, ihn davon abzubringen. Jedermann in seiner Umgebung teilte seine irrige Ansicht, und als ich sagte, daß meine Mission unbezahlt sei, wollte mir dies niemand glauben. * * * * * Das Leben zu Papeete wurde mir bald zur Last. Das war ja Europa -- das Europa, von dem ich mich zu befreien geglaubt hatte! -- und dazu noch unter den erschwerenden Umständen des kolonialen Snobismus und der bis zur Karikatur grotesken Nachahmung unserer Sitten, Moden, Laster und Kulturlächerlichkeiten. Sollte ich einen so weiten Weg gemacht haben, um das zu finden, gerade das, dem ich entflohen war! Aber ein öffentliches Ereignis interessierte mich doch. Der König Pomare war zu dieser Zeit tödlich erkrankt, und die Katastrophe wurde täglich erwartet. Die Stadt hatte allmählich ein sonderbares Aussehen angenommen. Alle Europäer, Kaufleute, Beamte, Offiziere und Soldaten lachten und sangen wie sonst auf den Straßen, während die Eingeborenen sich mit ernsten Mienen und gedämpfter Stimme vor dem Palast unterhielten. An der Rhede auf dem blauen Meer mit seiner in der Sonne oft jäh aufblitzenden, silberfunkelnden Klippenreihe herrschte eine ungewöhnliche Bewegung orangefarbener Segel. Es waren die Bewohner der benachbarten Inseln, die herbeieilten, den letzten Augenblicken ihres Königs -- Frankreichs definitiver Besitznahme ihres Landes beizuwohnen. Durch Zeichen von oben hatten sie Kunde davon erhalten: denn jedesmal, wenn ein König im Sterben liegt, bedecken die Berge sich an bestimmten Stellen bei Sonnenuntergang mit dunkeln Flecken. Der König starb und ward in großer Admiralsuniform öffentlich in seinem Palast ausgestellt. Dort sah ich die Königin Maraü -- dies war ihr Name --, die den königlichen Saal mit Blumen und Stoffen schmückte. -- Als der Leiter der öffentlichen Arbeiten mich wegen der künstlerischen Ausstattung des Leichenbegängnisses um Rat fragte, wies ich ihn an die Königin, die mit dem schönen Instinkt ihrer Rasse überall Anmut um sich verbreitete und alles, was sie berührte, zu einem Kunstwerk gestaltete. Bei dieser ersten Begegnung verstand ich sie jedoch nur unvollkommen. Menschen und Dinge, die so verschieden von denen waren, wie ich sie gewünscht, hatten mich enttäuscht, ich war angewidert von dieser ganzen europäischen Trivialität und zu kurze Zeit im Lande, um erkennen zu können, wieviel sich in dieser eroberten Rasse unter der künstlichen, verderblichen Tünche unserer Einführungen noch von Nationalität, Ursprünglichkeit und primitiver Schönheit erhalten hatte, ich war in mancher Beziehung noch blind. Ich sah auch in dieser bereits etwas reifen Königin nichts als eine gewöhnliche dicke Frau mit Spuren von edler Schönheit. Als ich sie später wiedersah, änderte ich mein erstes Urteil, ich unterlag dem Reize ihres »maorischen Zaubers«. Trotz aller Mischung war der tahitische Typus bei ihr sehr rein. Und dann gab die Erinnerung an ihren Vorfahren, den großen Häuptling Tati, ihr wie ihrem Bruder und der ganzen Familie ein Ansehen von wahrhaft imposanter Größe. Sie hatte die majestätische, prachtvolle Gestalt der Rasse dort, groß und doch anmutig, die Arme wie die Säulen eines Tempels einfach und fest, und der ganze Körperbau, diese gerade horizontale Schulterlinie, die oben spitz auslaufende Höhe erinnerte mich unwillkürlich an das heilige Dreieck, das Symbol der Dreieinigkeit. -- In ihren Augen blitzte es zuweilen wie von vage auftauchender Leidenschaft, die sich jäh entzündet und alles ringsum entflammt, -- und so...
This is a limited preview. Download the book to read the full content.







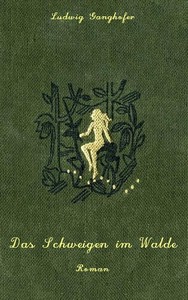
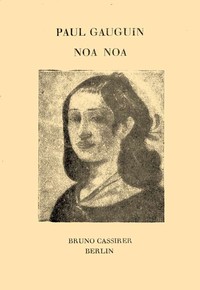
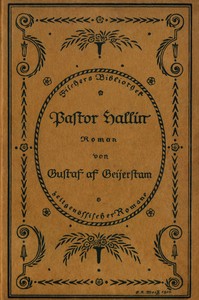

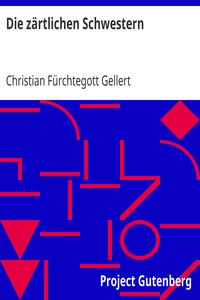
John Perez
9 months agoRead this on my tablet, looks great.